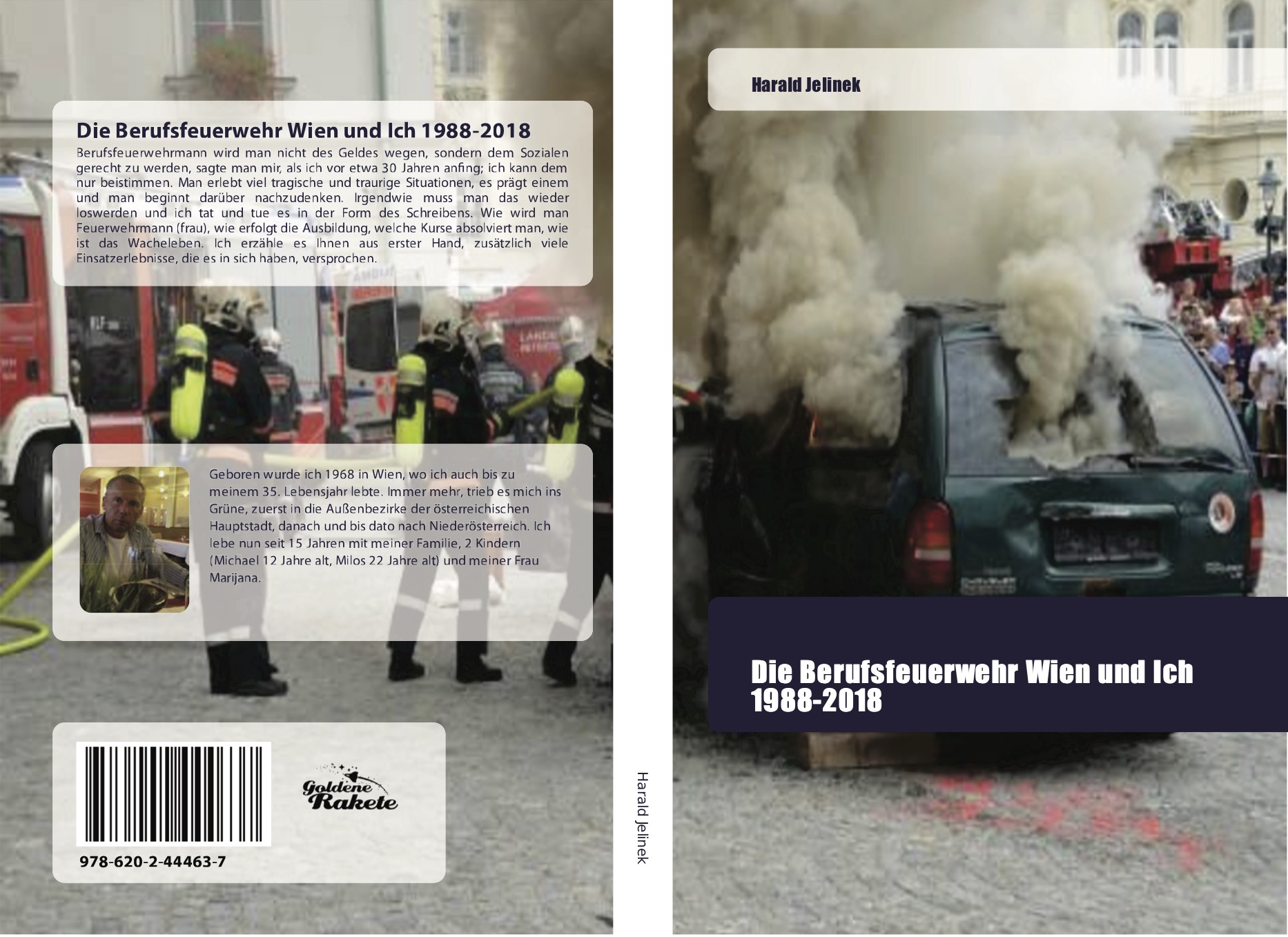Impressum
Betreiber der Webseite: Harald Jelinek
Anschrift: Edelspitzweg 17/1, 2301 Mühlleiten
E-Mail: h.jelinek@gmx.at
Mobil: +43660 5633455
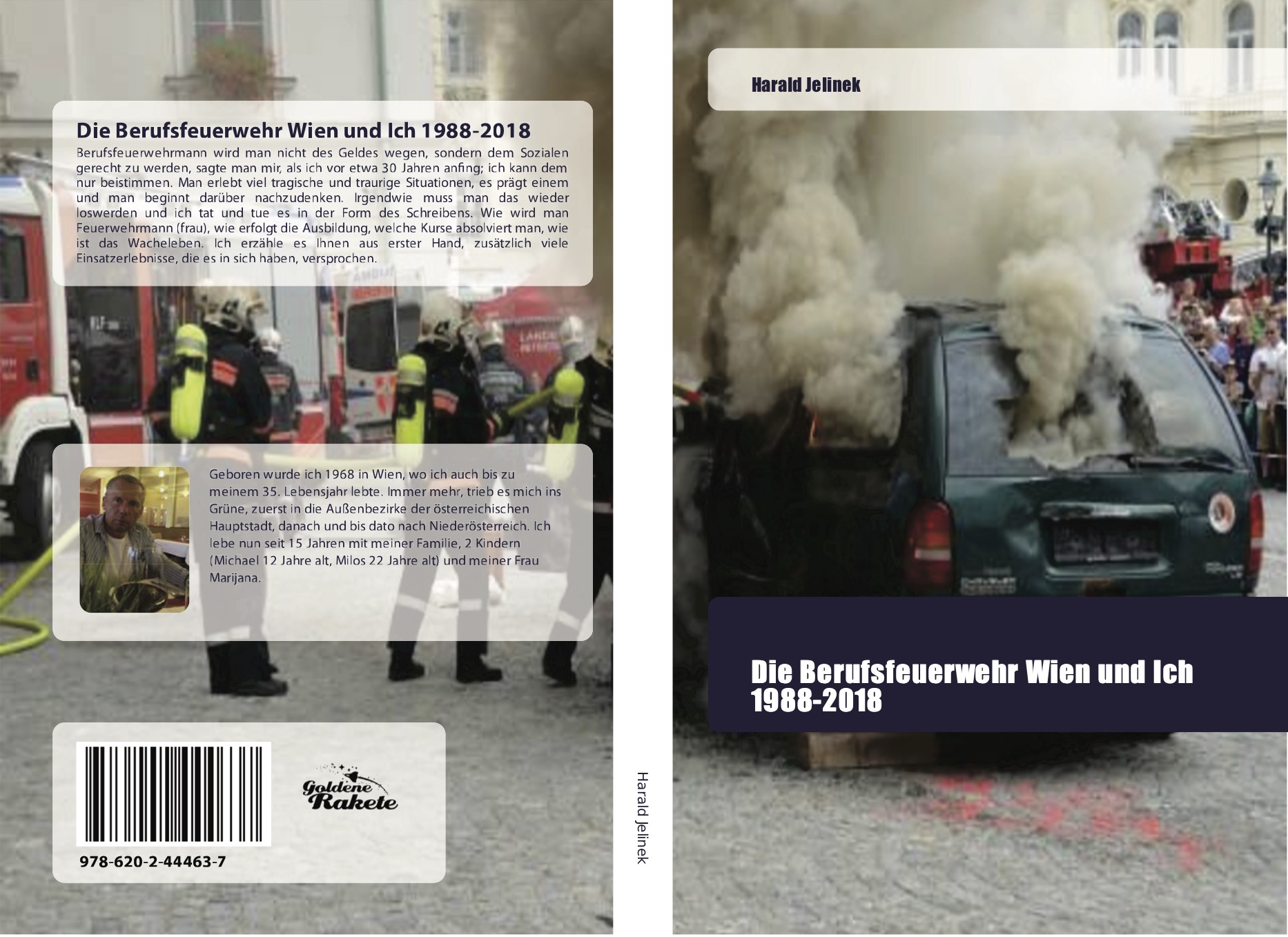
Betreiber der Webseite: Harald Jelinek
Anschrift: Edelspitzweg 17/1, 2301 Mühlleiten
E-Mail: h.jelinek@gmx.at
Mobil: +43660 5633455